3.Jahrgang, No. 50, Seite 785
Reprint Seite 278
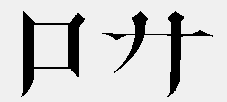
oder
Kong-Kheou, das Ehrenwort.
Von K. May.
Verfasser von "Der Sohn des Bärenjägers", Geist der Llano estakata".
(Fortsetzung.)
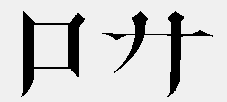
Von K. May.
Verfasser von "Der Sohn des Bärenjägers", Geist der Llano estakata".
(Fortsetzung.)
Gottfried ließ sich nur ganz selten mit einem ernsten Stücke hören, wenn er es aber that, so mußte man ihn bewundern. Er war in seiner Art ein Virtuos auf dem Instrumente, welchem scheinbar kein richtiger Ton zu entlocken war. Der beste Fagotter hatte auf Gottfrieds Fagott nicht die leichteste Melodie fertig gebracht; dieser letztere aber kannte alle guten und schlechten Eigenschaften seines Instruments. Er allein wußte, wo die herrlichsten Töne in demselben zu suchen und wie sie herauszubringen seien. Er hatte sein Fagott studiert wie ein Reiter sein häßliches Pferd, welches keinem gehorcht, aber zum trefflichsten Rosse wird, sobald sein Herr sich in den Sattel geschwungen hat.
Richard hatte oft mit ihm gespielt. Er kannte alle seine Lieblingsstücke, zu deren besten das genannte gehörte. Er begann die Einleitung; dann fiel Gottfried ein. Er blies die Melodie des bekannten, innigen, aber anspruchslosen Liedes in einfacher Weise bis zu Ende. Dann ließ er eine leichte Variation folgen; es kam eine schwierigere, und dann perlten die Töne in Sechzehntel- und Zweiunddreißigstelnoten so zart und lieblich, so rein und eigenartig voll hervor, daß selbst der anspruchsvollste Kenner hätte zugeben müssen, daß er weder diesem Gottfried noch seiner alten Fagottoboe so etwas zugetraut habe. Es war wirklich eine außerordentliche Leistung, und zwar auf einem Instrumente, welchem man die Bedeutung eines Soloinstruments sonst abzusprechen pflegt.
Die Zuhörer saßen lautlos da. Der Onkel Daniel fühlte sich tief ergriffen. Eine echt deutsche Melodie, in dieser Weise vorgetragen, mußte auf ihn, der sich so nach seiner Heimat sehnte, einen mehr als gewöhnlichen Eindruck machen. Er mußte sich Mühe geben, nicht zu weinen, und rief, als der Gottfried geendet hatte und sein Fagott neben das Pianino lehnte:
»Herrlich, herrlich! Ich danke Ihnen außerordentlich, Herr Jones! Das ist eine deutsche Melodie. Sie können auch solche spielen?«
Er hatte englisch gesprochen.
»Yes,« antwortete der Gottfried.
»Und die haben Sie in England gelernt?«
»Yes. «
»Spielt und singt man denn dort auch deutsche Lieder?«
»Yes.«
»Bitte, würden Sie noch eins blasen?«
»Yes.«
Dieses »Yes« war das einzige englische Wort, von welchem er genau wußte, daß er es richtig ausspreche. Der Methusalem befreite ihn aus seiner Verlegenheit, indem er Richard bat, einige deutsche Lieder zu spielen.
Der Gymnasiast folgte dieser Aufforderung, hütete sich aber sehr, diese Lieder zu singen. Der Onkel durfte ja noch nicht wissen, daß seine Gäste des Deutschen mächtig seien.
Dennoch machten die Melodien auf den Hauswirt den Eindruck, daß er ganz schwermütig wurde. Er bemerkte, daß er dadurch die vorherige heitere Stimmung seiner Gäste schädige und entschuldigte sich:
»Ich bitte um Verzeihung! Der Deutsche bleibt eben ein Melancholikus, wohin er nur kommen mag. Ich liebe mein Vaterland und bin doch durch die Verhältnisse abgehalten, es jemals wiederzusehen. Das stimmt mich, So oft ich daran denke, trübe. Lassen Sie also lieber nun etwas recht Munteres, Lustiges hören.«
»Ja,« stimmte der Methusalem bei, »Mister Jones, blasen Sie doch einmal das famose Dings, welches, glaube ich, 'Auf dem Bauernhofe' überschrieben ist!«
Gottfried verstand das Englische weit besser, als er es sprach. Er wußte, was der Blaurote meinte.
» Yes, « sagte er, indem er wieder zu seinem Instrument griff. Und leise flüsterte er Richard zu:
»Mach deine Sache jut und falle mich nicht so oft aus die Taktmäßigkeit wie jewöhnlich! Wenn dat Ding jut jespielt wird, sollst du sehen, wie sich diese Chinesigen vor Lachen die Bäuche halten. Also los!«
Richard spielte die sehr ernste, ja würdig gehaltene Einleitung. Dann setzte der Gottfried sein Fagott an, im nächsten Augenblicke wieder ab - ein Hahn hatte gekräht. Das hatte so täuschend geklungen, daß die Chinesen in alle Ecken schauten, um den Hahn zu sehen, und auch der Dicke sagte:
»Een haan! Ik zie hem niet - ein Hahn! Ich sehe ihn nicht! «
Gottfried hatte das Mundstück wieder zwischen den Lippen - eine ganze Schar von Gänsen schnatterte; Enten quakten und Tauben girrten. Nun erst sahen und hörten die mit der Kunst des Wichsiers Unbekannten, daß diese Stimmen aus seinem Instrumente kamen. Ein Ochse brummte, ein Pferd wieherte; dann meckerten einige Ziegen. Das war so vortrefflich nachgeahmt, daß die Hörer meinten, die Tiere vor sich zu sehen. Eine Katze pfauchte, und ein Hund knurrte darauf. Die Katze miaute laut, und der Hund kläffte hinterdrein. Die Katze schrie förmlich auf, und der Hund bellte und heulte aus Leibeskräften. Das gab einen ganz entsetzlichen Lärm, welcher aber so genau nach dem Takte ging, daß jeder Ton mit der Begleitung harmonierte. Diese Stimmen und andre wiederholten sich in der verschiedensten Weise und Reihenfolge, bis sie endlich so rasch hintereinander und scheinbar durcheinander erschallten, daß die Zuhörer sich wirklich die Ohren zuhielten und aus Leibeskräften lachten.
»So,« sagte Gottfried, indem er sein Instrument hinlehnte, »dat hast du jut jemacht, Richard. Du bist nicht ein einziges Mal aus das Konzept jekommen, und ich denke, dat wir Ehre einjelegt haben. Nun komm! Wir sind keine Freunde von diejenigte Arbeitsteilung, dat wir nur blasen, wenn die übrigen trinken.«
Durch dieses letzte Musikstück war die muntere Laune neu angeregt worden und sie hielt vor, bis niemand, selbst der Dicke nicht, mehr trinken wollte. Der T'eu wünschte, schlafen zu gehen, und so wurde die Tafel aufgehoben.
»Ik eet und drink ook niets meer,« sagte der Dicke; »maar slapen kan ik ook nook niet. Ik moet met gij spreken, Mijnheer Stein - ich esse und trinke auch nichts mehr; aber schlafen kann ich auch noch nicht. Ich muß mit Ihnen sprechen, Herr Stein.«
»Worüber?« fragte der Onkel.
»Dat word ik gli zeggen. Gaan wij in uw vertrek - das werde ich Ihnen sagen. Gehen wir in Ihr Zimmer!«
»Gern, wenn Sie es wünschen. Doch bitte, hier zu warten, bis ich die andern Herren begleitet habe!«
Da fiel dem Dicken ein, daß ja gesungen werden solle. Er hatte versprochen, mitzusingen. Darum meinte er jetzt:
»Ik kan het ook morgen zeggen. Ik wil met slapen gaan - ich kann es auch morgen sagen. Ich will mit schlafen gehen.«
So schloß er sich also den andern an, welche der Onkel in ihre Zimmer brachte. Mit dem Methusalem in der Stube desselben angekommen, bemerkte der Wirt:
»Das war ein höchst genußreicher Abend, für welchen ich Ihnen nicht genug Dank sagen kann. Solche Stunden habe ich hier noch nicht erlebt.«
»Haben Sie wirklich ganz darauf verzichtet, die Heimat wieder zu sehen?«
»Ja. Einen Käufer finde ich nicht. Und soll ich meine Schöpfung und meine Arbeiter verlassen?«
»Besitzen Sie nicht Verwandte, welche Sie zu sich rufen können? Die Anwesenheit derselben würde Ihnen doch wenigstens einigermaßen die Heimat ersetzen.«
»Gewiß. Ich habe Verwandte und hegte auch schon denselben Gedanken wie Sie. Ich habe geschrieben.«
»Und werden sie kommen?«
»Das weiß ich nicht, da ich keine Antwort erhalten habe. Vielleicht sind sie verschollen.«
»Nun, in Deutschland ist das doch nicht so leicht.«
»Warum nicht? Ich hatte einen Bruder, welcher Lehrer war. Er ist wohl tot. Seine Witwe hat mit den Kindern nicht von der armen Pension zu leben vermocht. Nun sind sie auseinander gegangen, eins dahin und das andre dorthin, und keins ist mehr aufzufinden. Ich werde dafür bestraft, daß ich ihnen so lange Jahre keine Nachricht von mir zugehen ließ.«
»Nun, man darf die Hoffnung nie ganz aufgeben.«
»Das wohl; aber ich werde morgen, oder vielmehr heut, denn es ist schon nach Mitternacht, und um ein Uhr bin ich geboren, sechsundsechzig Jahre. Da hat man nicht mehr viel Zeit zum Hoffen und Warten übrig. Ihre Gegenwart macht mir den Geburtstag diesmal zum wirklichen Freudentag. Wir werden ihn feiern, denn ich habe Zeit dazu. Meine Leute arbeiten nicht, und ich werde Essen und Trinken unter sie verteilen lassen. Schlafen Sie jetzt wohl und ein frohes Wiedersehen nach dem Erwachen!«
Er ging.
»Noch vor dem Erwachen, ja, noch vor dem Einschlafen,« lachte der Methusalem leise hinter ihm her.
Er wartete noch eine Viertelstunde, bis im Hause alles ruhig war; dann wollte er zu Richard und Gottfried gehen. Aber da wurde seine Thür leise geöffnet; der letztere steckte den Kopf herein und fragte:
»Sie warten auf uns? Dürfen wir eintreten, jeehrter Freund und Ständchenjenosse?«
»Ja, komm herein! Wo sind denn die andern?«
»Sie folgen mich hinterdrein. Da sehen Sie dat janze Corps der Rache.«
Er schob Richard, Turnerstick und den Dicken herein. Draußen aber standen noch Liang-ssi, dessen Bruder, van Berken und auch der Bettlerkönig.
»Gut!« meinte Degenfeld. »So sind wir nun alle beisammen. Ist der Herr in seiner Schlafstube?«
»Ja. Liang-ssi hat eine Leiter an dat Fenster jelegt und den Spion jemacht. Soeben hat sich der Onkel zur Ruhe jelegt, die wir ihm aber nicht lassen werden.«
»So kommt! aber leise!«
»Ik ook?« fragte der Mijnheer.
»Ja. Wir müssen alle beisammen sein.«
»Und ik zal ook met zingen?«
»Nein. Sie schweigen.«
»Waarom?«
»Weil Sie nicht singen können.«
»O, ik kan zingen, ik kan zeer goed zingen!«
»Das ist möglich. Da wir aber noch keinen Beweis davon haben und es uns auch an der Zeit fehlt, uns diesen Beweis geben zu lassen, so ersuche ich Sie, nicht mitzusingen. Bitte, kommen Sie jetzt!«
Die vorher auf dem Korridor brennende Lampe war ausgelöscht worden. Die Herren hatten aber ihre Lichter mitgebracht; also gab es Beleuchtung genug. Sie schlichen sich bis zur Thür, hinter welcher das Wohnzimmer des Onkels lag. Degenfeld klinkte leise; sie ging auf. Die drei, der Methusalem, Gottfried und Richard, traten ein. Links von ihnen führte die Thür in das Schlafkabinett des Onkels. Sie war nur angelehnt; der Schein der Lichter fiel durch die Spalte hinaus. Er sah es und fragte auf chinesisch
»Wer ist da draußen?«
Anstatt der Antwort erklang der Bierbaß des Methusalem: »Was ist des Deutschen Vaterland?« Gottfried und Richard fielen kräftig ein. Aber schon nach den ersten zehn oder zwölf Takten lauschten sie selbst erstaunt auf. Sie sangen nicht allein. Zu ihren drei Stimmen hatte sich ein wundervoller Tenor gesellt, ein Tenor, so glockenhell, so rund und trotz aller Zartheit so mächtig, daß sie sich umdrehten.
Da stand hinter ihnen der Dicke und sang mit ihnen:
Als das Lied zu Ende war, stand der Onkel unter der Thür. Sein Gesicht war ein einziges großes Fragezeichen. Seine faltigen Wangen hatten sich gerötet, und seine Augen leuchteten vor Erregung. Mit fast zitternder Stimme rief er:
»Sie singen dieses prächtige Lied! Sie singen deutsch! Sie verstehen also auch deutsch! Warum haben Sie mir das nicht früher gesagt?«
»Um Ihnen zu überraschen,« antwortete der Gottfried voreilig. »Wir bringen Ihnen dieses Ständchen zum Jeburtstage und dazu die Erfüllung Ihres Lieblingswunsches. Sehen Sie sich diesen wohljeratenen Jüngling an, diesen - - - o weh! Hat ihm schon! Da ist es mit meine schöne Rede aus!«
Richard hatte sich nicht länger halten können. Noch während der Gottfried sprach, war er mit den Worten: »Onkel, lieber Onkel, ich bin dein Neffe!« auf Stein zugeeilt und hatte seine Arme um ihn geschlungen. Der Onkel stand starr vor freudigem Schreck. Die Arme hingen ihm schlaff herab.
»Mein Neffe - - Du - du bist mein Neffe?« stammelte er.
»Hinaus!« flüsterte Degenfeld den andern zu, indem er sie zurückdrängte. »Hier sind wir von jetzt an überflüssig.«
Er schob die Thür hinter sich zu. Drin erklangen die Stimmen des Oheims und des Neffen, schluchzend und jubelnd zugleich. Auf dem Korridor sagte der Gottfried:
»Wohin jehen wir einstweilen?«
»EinstweiIen?« antwortet der Blaurote. »Von einem EinstweiIen ist natürlich keine Rede. Wir gehen schlafen.«
»Dat wäre höchst incoulant!«
»Warum?«
»Weil der Onkel uns bald suchen wird, um uns zu danken.«
»Du willst einen Dank haben für deinen zweiten Bänkelsängertenor? Schäme dich!«
»Na, so war's nicht jemeint. Aberst er wird noch mit uns reden wollen. Wir werden ihm erzählen sollen!«
»Dazu ist morgen besser Zeit als jetzt. Uebrigens kann und wird Richard ihm alles erzählen. Lassen wir die beiden allein!«
Er ging nach seiner Schlafstube und legte sich nieder. Die andern mußten wohl oder übel seinem Beispiele folgen. Noch war er nicht eingeschlafen, so klopfte man an seine Thür. Auf seine Frage antwortete Richards Stimme.
»Onkel Methusalem, du sollst zu Onkel Daniel kommen.«
»Wozu?«
»Wir wollen hinunter in den Speisesaal, du sollst erzählen.«
»Wo sind die andern?«
»Die soll ich auch mitbringen, bin aber erst zu dir gegangen.«
»So laß sie liegen, und entschuldige auch mich. Ihr habt ein Recht, ungestört zu sein, und du kannst ja auch erzählen. Morgen ist ein langer Tag, ein Geburtstag, den wir feiern sollen. Da muß ich ausgeschlafen haben. Gute Nacht!«
Mit diesem Bescheide mußte Richard sich entfernen. Der Methusalem aber schlief mit dem Bewußtsein ein, seine Aufgabe mit der jetzigen Stunde ganz und voll gelöst zu haben.
Am Morgen wurde er durch ein abermaliges Klopfen geweckt. Er sah an die Uhr. Die Sonne schien schon hell, aber es war erst sieben.
»Wer klopft denn?« fragte er ärgerlich.
»Ich,« antwortete der Gottfried.
»Warum?«
»Erheben Sie sich aus die Eiderjänse! Es ist höchst wahrscheinlich ein Malheur passiert, wenn es nicht bloß eine Dummheit ist, die er bejangen hat.«
»Wer?«
»Der Mijnheer.«
»Was ist mit ihm?«
»Dat ist's eben, wat wir nicht wissen. Er ist verschwunden.«
»Unsinn!«
»Möglich, dat es nur ein Unsinn ist! Aberst er ist wirklich fort.«
»Wann denn?«
»Dat weiß nicht mal Buddha.«
»Warte, ich komme!«
Er kleidete sich schnell an und trat hinaus. Da stand der Gottfried mit Richard und Turnerstick.
»Endlich!« meinte der erstere. »Sollte man es denken, dat so ein Dicker solche dumme Streiche machen könnte!«
»Er hat doch mit dem Kapitän in einem Zimmer geschlafen, denke ich. Dem muß er doch etwas gesagt haben!«
»Ist ihm nicht eingefallen,« antwortete Turnerstick. »Er schnarchte wie ein Walroß, so daß ich stundenlang nicht einschlafen konnte. Endlich fand ich ein wenig Ruhe. Als ich dann erwachte, war er fort.«
»Er wird spazieren gegangen sein.«
»Der? So ein Langschläfer? Das ist ihm nicht eingefallen!«
»Wo sind denn seine Sachen?«
»Die hat er mit, die Gewehre, den Ranzen, den Schirm, kurz, alles! Und das ist es eben, was mich so besorgt macht.«
»Pah! Wie können Sie denken, daß der Mijnheer uns durchgeht. Von seinen Sachen trennt er sich überhaupt nie. Daß er sie mitgenommen hat, ist kein Beweis dafür, daß er hat verschwinden wollen.«
»Aber daß er vor uns aufgestanden ist!«
»Das ist freilich höchst ungewöhnlich von ihm. Ist Onkel Daniel schon auf?«
»Jedenfalls,« antwortete Richard. »Wir haben bis Tagesanbruch in seiner Stube gesessen. Dann schickte er mich schlafen. Er selbst, sagte er, werde aber wohl nicht schlafen können.«
»Wollen fragen und suchen.«