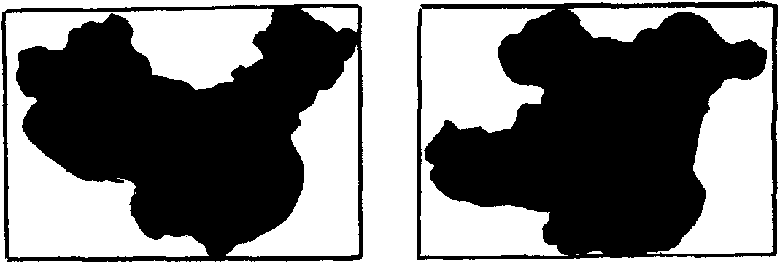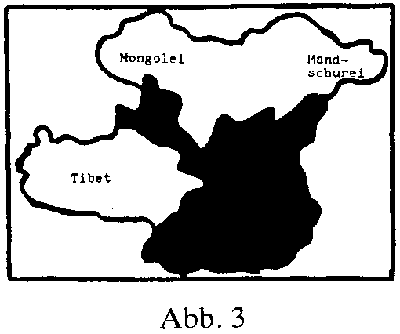//322//
BERNHARD KOSCIUSZKO
Illusion oder Information? · China im Werk
Karl Mays
0. Einleitung
China! Wunderbarstes Land des Ostens, riesiger Erdendrache, der seinen Zackenschwanz im tiefen Weltmeer badet, den einen Flügel in die Eisregionen Sibiriens und den andern in die dampfenden Dschungeln Indiens schlägt, und der, vom rasenden Teifun an das Gestade getrieben, über rauschende Flüsse, weite Seen, über Berge und Thäler auf nach Westen steigt, um seinen Kopf über die höchsten Giganten der Gebirge zu heben, die schreckliche Wjuga der Gobi zu atmen und aus den Wassern des Manasarowar zu trinken, werde ich es wagen dürfen, dir zu nahen, und werde ich deinen feindseligen Basiliskenblick mit meinem Barbarenauge ertragen können?(1)
Mit diesen emphatischen Worten beginnt Karl May seine Erzählung "Der Kiang-lu". Ein Blick in den Atlas läßt den kritischen Leser jedoch stutzen. Selbst bei großzügigster Auslegung ist im Umriß des "Reiches der Mitte" nicht das Bild eines geflügelten Drachen auszumachen (Abb. 1); doch das China des vorigen Jahrhunderts könnte ja einen anderen Grenzverlauf gehabt haben. Aus dem Sohr-Berghaus-Atlas von 1877 gewinnt man in der Tat einen anderen Anblick (Abb. 2).
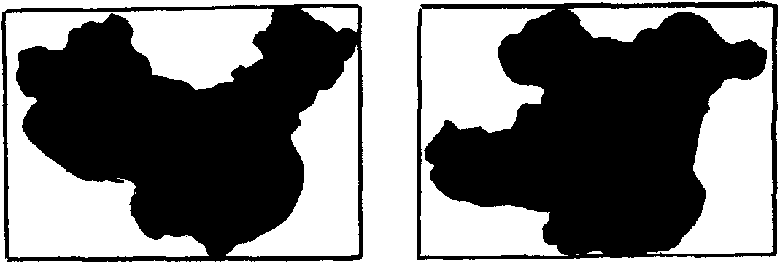
Ein geflügelter Drache ist aber immer noch nicht erkennbar. Ist da die Phantasie mit May durchgegangen? Schauen wir etwas genauer hin: die Karte im 1877er Atlas ist von feinen Linien durchzogen, das große Reich gliedert sich in mehrere Landesteile: Mongolei, Mandschurei, Tibet und das eigentliche China:
//323//
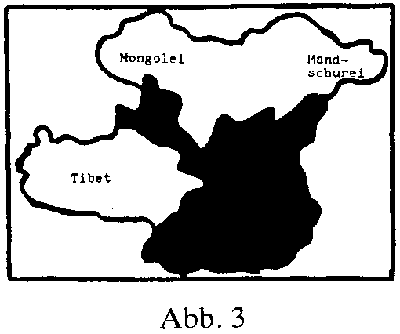
Das genaue Hinsehen läßt Mays Bild Gestalt annehmen. Das eigentliche China sieht unzweifelhaft wie ein die Flügel ausspannender Drache aus, dessen Schwanz man sich im Weltmeer badend zu denken hat.
Darf aus diesem Exempel der Schluß gezogen werden, daß man bei May schon sehr genau den Angaben auf den Grund gehen muß, wenn man ein Urteil über die Solidität seiner völkerkundlichen und geographischen Angaben abgeben will? Diese Arbeit will zeigen, ob man »Karl Mays China-Bild nur dann gerecht werden [kann], wenn man sein China, und zwar sowohl das [ . . . ] bunte Eingeborenenchina des "Blauroten Methusalem" wie das China der edlen und weisen Friedensfreunde auf der Insel Ocama als Länder und Nationen ansieht, die nie auf unserem Globus beheimatet waren oder sind.«(4)
Grundlage dieser Untersuchung sind die Erzählung "Der Kiang-lu", erschienen 1880 in "Deutscher Hausschatz", VII. Jahrgang, ab 1893 in den Band XI "Am Stillen Ozean" übernommen, und der Jugendroman "Der blaurote Methusalem", der 1888/89 in der Jugendzeitschrift "Der gute Kamerad" (III. Jg. ) unter dem Titel "Kong-kheou, das Ehrenwort" veröffentlicht wurde und 1892 als Buch bei der Union Deutsche Verlagsgesellschaft, Stuttgart, herauskam.(5) Das Chinabild in Mays Roman "Und Friede auf Erden!" (Gesammelte Reiseerzählungen Bd. XXX, 1904) soll nur kurz am Schluß zur Sprache gebracht werden, da das geographische China in diesem Werk Mays keine Rolle spielt.
Bevor jedoch die eigentliche Untersuchung beginnen kann, muß noch zweierlei geklärt werden: erstens die Handlungszeit der China-Erzählungen Mays, zweitens die Quellen, auf die May sich bei der Gestaltung dieser Erzählungen stützte.
a) Die Handlungszeit
Für den "Blauroten Methusalem" ist die Handlungszeit ziemlich genau festzulegen: »Der alte Teehändler Ye-Kin-Li mußte nämlich emigrieren, weil er als angeblicher Anhänger der Taiping-Bewegung galt, die in den 60er Jahren in China eine politisch-religiöse Revolution anstrebte, dann aber nach beachtlichen Anfangserfolgen doch unterlag. Der
//324//
"Blaurote Methusalem" nun spielt acht Jahre nach den letzten Zuckungen dieser Bewegung, was auf das Jahr [ . . . ] 1874 hinführt.«(6)
Die Erzählung "Der Kiang-lu" ist nicht zu datieren, da entsprechende Hinweise Mays fehlen. Roland Schmid schreibt anläßlich einer Untersuchung der Gestalt Kapitän Turnersticks, daß May sich seine Fernost-Erlebnisse ("Der Ehri" "Der Kiang-lu") »weit früher« als 1870 vorgestellt habe, gibt aber nicht an, worauf er seine Behauptung stützt.(7) [Da - sic!] aus werkinternen Gründen – der Held, der Old Shatterhand ist,(8) kann nicht jünger als zwanzig Jahre alt sein – ist die Handlung des "Kiang-lu" doch wohl in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts anzusiedeln.
b) Die Quellen
Bisher sind zwei Reisewerke als Quellen für Mays China-Kenntnisse identifiziert worden:
Évariste-Régis Huc/Joseph Gabet: Wanderungen durch das Chinesische Reich. In deutscher Bearbeitung herausgegeben von Karl Andree. Leipzig, 1865,
und
Wilhelm Heine: Reise um die Erde nach Japan an Bord der Expeditions-Escadre unter Commodore M. C. Perry in den Jahren 1853, 1854 und 1855, unternommen im Auftrage der Regierung der Vereinigten Staaten. Leipzig 1856.
Auf beide Werke als Quellen Mays hat schon Ansgar Pöllmann hingewiesen.(9) Zitiert und verwiesen wird auf diese Werke mit den Siglen HEINE und HUC. Weitere Quellen werden jeweils in den Anmerkungen benannt.
Der Franzose Évariste-Régis Huc (1813–1860) war seit 1839 erst in Macao, dann ab 1841 am Südrand der Mandschurei als Missionar tätig. Im September 1844 brach er mit seinem Vorgesetzten Joseph Gabet (1808–1853) auf zu "Wanderungen durch die Mongolei nach Thibet zur Hauptstadt des Tale Lama" (so der Titel der ersten Reisebeschreibung der beiden – Paris 1850/dt. Leipzig 1855. Karl May besaß dieses Buch.)(10) Sven Hedin bescheinigt: »Over the whole book there is an atmosphere of perfect honesty and love of truth.«(11) In Lhasa endlich angekommen, müssen die beiden Missionare auf Drängen des chinesischen Gesandten sehr schnell wieder abreisen. Am 15.3.1846 brechen sie auf und reisen quer durchs chinesische Reich hinunter nach Kanton, dann nach Macao. Die Reiseberichte verfaßte Huc allein. Während Gabet China verließ (er starb in Brasilien), blieb Huc längere Zeit in Macao, ging dann nach Kanton und »durchwanderte China zum dritten
//325//
Male. [ . . . ] 1852 sah ich das Vaterland wieder.« (HUC 359). In seinem Vorwort zu dem zweiten Reisebericht Hucs (Paris 1854/dt. Leipzig 1856) gibt Karl Andree, der Herausgeber und Bearbeiter der deutschen Ausgabe, an, wie Huc seine Ausführungen verstanden wissen wollte:
»Huc bemerkt in seiner Vorrede, er wolle so viel in seinen Kräften stehe dazu beitragen, eine Menge irriger und alberner Ansichten zu beseitigen, welche seither über China in Umlauf gekommen seien. [ . . . ] Ganz richtig wird von Huc hervorgehoben daß die sogenannten Touristen nicht geeignet sind, richtige Ansichten über Land und Leute in China zu verbreiten. Wer eine Weile in halb europäisirten Hafenplätzen lebt, lernt darum China noch nicht kennen. Dazu ist es unumgänglich nöthig daß man sich mit dem chinesischen Leben identificirt, lange Zeit im Lande verweilt, und sich gleichsam selber zum Chinesen macht. "Das habe ich v i e r z e h n J a h r e l a n g gethan, und deshalb bin ich im Stande genaue Auskunft über ein Reich zu geben das mir zum Adoptiv-Vaterlande wurde. Denn ich dachte nicht daran jemals nach Europa heimzukehren. Die Umstände zum Beobachten sind mir günstig gewesen. Ich durchreiste mehrmals die verschiedenen Provinzen, hatte Gelegenheit Vergleiche anzustellen, und lernte auch die höheren Kreise der Gesellschaft kennen."
"Der Leser findet in dem vorliegenden Werke keineswegs eine Menge von erbaulichen Einzelheiten, wie fromme Seelen und gläubige Gemüther sie vielleicht aus der Feder eines Missionairs erwarten. Ich wende mich an das große Publicum; ich will dasselbe China kennen lehren, nicht etwa blos Dinge mittheilen die auf unsere Missionen Bezug haben."« (HUC X–XII)
Der andere Gewährsmann Mays, Wilhelm Heine (* 1827 in Dresden – † 1885 in der Lößnitz), war Landschaftsmaler und wanderte 1849 nach New York aus. 1851 bereiste er Nicaragua und begleitete anschließend (1853–1855) M. C. Perrys Expedition, die ihn über Kapstadt, Ceylon, Singapur, Hongkong, Kanton, Macao, Shanghai und die Bonin-Inseln nach Japan führte. Im Jahre 1859 besuchte er dann Tripolis und kehrte 1860/61 mit der preußischen Expedition unter Friedrich Graf zu Eulenburg nochmals nach Ostasien zurück.(12) Heine widmet seinen Bericht von der Perry-Expedition Alexander von Humboldt, der daraufhin schreibt: »Wer die Natur so wahr aufzufassen, und im Bilde darzustellen weiß, der findet auch leicht das NATURWAHRE in der SPRACHE« (HEINE XIf.).
Zusammenfassend darf wohl behauptet werden, daß May für seine in China spielenden Werke solvente Quellen benutzt hat.
1. D i e h is t o r i s c h e n V e r h ä l t n i s s e
1.1. Geschichte Chinas im 19. Jahrhundert
Daß China eines der ältesten Kulturländer der Erde ist, mit einer Geschichte, die bis ins 18. vorchristliche Jahrhundert belegt ist, ist hinläng-
//326//
lich [hinlänglich] bekannt. Hier soll nur Chinas Geschichte im 19. Jahrhundert Thema sein, ein Kapitel, das an Farbigkeit nichts zu wünschen übrig läßt.
Es ist jedoch erforderlich, kurz etwas weiter auszuholen: Im 17. Jahrhundert wurde die fast 300 Jahre (1368–1644) herrschende Ming-Dynastie von der Dynastie der Ch'ing-Kaiser (1644–1911) abgelöst. Diese Herrscher waren Mandschus. Die Mandschus, ein kriegerischer Tungusenstamm, eroberten China von Norden her, bildeten als Kriegs- und Amtsadel eine neue Herrschaftsschicht und führten unter den Kaisern K'ang-hsi (1662–1722), Yung-cheng (1723–1735) und Ch'ien-lung (1736–1796)(13) das chinesische Reich zu einer bis dahin nicht gekannten wirtschaftlichen und politischen Blüte. »Die lange Regierung des Ch'ien Lung . . . war die glänzendste Periode der Mandschu-Dynastie und ist oft als die glorreichste Epoche der chinesischen Geschichte bezeichnet worden, doch sie war nur eine schillernde und eindrucksvolle Fassade, hinter der sich intellektuelle und künstlerische Stagnation und ärgste Korruption der Beamtenklasse verbargen.«(14) Mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts setzte der unaufhaltsame Verfall des großen Reiches ein, verursacht durch die inneren Verhältnisse und durch das imperialistische Vorgehen europäischer Mächte.
Die inneren Verhältnisse Chinas zu dieser Zeit wurden von zwei Faktoren bestimmt, von der hohen Bevölkerungszahl und von der Art der Mandschu-Herrschaft. Durch den wirtschaftlichen Fortschritt im 18. Jahrhundert wuchs die Einwohnerzahl des Reiches explosionsartig; 1710: 116 Millionen Menschen, 1814: 375 Millionen.(15) Damit war die Grenze der möglichen Nahrungsmittelproduktion und des zur Verfügung stehenden Landes erreicht. Der Lebensstandard sank rapide, der Landadel konnte den gewohnten Lebensstil nicht mehr halten, Korruption und Ausbeutung griffen immer mehr um sich. Die mandschurischen Eroberer, die nur eine kleine Minderheit (Verhältnis etwa 1:35) bildeten, entwickelten eine besondere "Psychologie der herrschenden Klasse", um ihre Herrschaft zu stabilisieren. Da sie keine eigene Tradition besaßen, »wurden die Mandschu-Fürsten und -Höflinge chinesischer als die Chinesen selbst. Sie übernahmen und protegierten die strengsten konfuzianischen Traditionen. [ . . . ] Sie erkannten, daß sie das Reich nur regieren konnten mit der Unterstützung der chinesischen Gelehrten, der traditionellen herrschenden Klasse. Ausschließliche Begünstigung der Künste und der Literatur, die diese Klasse pflegte, war der sicherste Weg, ihre Achtung zu gewinnen und sich ihre Loyalität zu sichern. [ . . . ] Jede Kunst und jede Idee, die diesen Vorbildern nicht entsprachen, wurde ignoriert oder verachtet [ . . . ] Zu dieser verachteten Art von Wissen, das nicht konfuzianisch und daher unwichtig war, zählten die neuen in Europa entwickelten Wissenschaften. Diese extrem konservativen Ansichten wurden von der gesamten Beamtenhierarchie geteilt, von Chinesen und Mandschus. [ . . . ] Die Prüfungen
//327//
wurden konventioneller und klassischer, entfernten sich immer mehr von der Wirklichkeit. [ . . . ] Zur wirklichen Ursache des schnellen Niedergangs des Mandschu-Reichs [ . . . ] wurde also die intellektuelle Stagnation.«(16)
Diese Stagnation hatte eine weitere Ursache in der Verteilung der Stellungen im Staatsdienst. Mandschus durften ausschließlich im Staatsdienst tätig sein, die Hälfte aller Stellen war für sie reserviert. Das jedoch bedeutete, daß sie, da ohne Konkurrenz, keine besonderen Fähigkeiten, Begabungen benötigten, um hohe Stellungen zu bekleiden. Die Folge war, daß Unfähigkeit und geringer Diensteifer in Verwaltung und Verteidigungswesen weit verbreitet waren, daß die Kampfkraft der Armee recht gering war. Verhängnisvoll wurde die Funktionsuntüchtigkeit des chinesischen Militärs, als europäische Mächte zum Sturm auf China ansetzten. Ursache für das Interesse an China waren wirtschaftliche Belange. Die industrielle Entwicklung, insbesondere in England, forderte einen exportgünstigen Weltmarkt. Die Chinesen jedoch waren an Handelsbeziehungen nicht sehr interessiert: der chinesische Kaiser teilte dem englischen König 1793 mit, daß das chinesische Reich wirtschaftlich autark sei und die Waren der "Barbaren" nicht brauche. Der Handel mit Europäern war jedoch nicht ganz unterbunden: in Kanton wurden Warengeschäfte zwischen der englischen Ostindiengesellschaft und lizenzierten chinesischen Kaufleuten getätigt. In der Hauptsache wurde Tee aus China importiert. Da die Chinesen aber nicht in gleichem Maße englische Waren kauften, stimmte die englische Handelsbilanz nicht. Das änderte sich, als 1773 die Ostindiengesellschaft das Opiummonopol erhielt und aus Indien Opium in großen Mengen nach China exportierte. Ab 1825 wurde dadurch die Handelsbilanz Chinas negativ. Es wurde in Silber bezahlt, Silber jedoch war in China knapp (China hatte eine Silberwährung). Die Staatsfinanzen kamen in schwere Bedrängnis. Doch nicht nur wirtschaftlich führte der Opiumhandel zum Verfall des Reiches. 1838 schätzte ein hoher chinesischer Beamter, »daß mehr als 1 % der Gesamtbevölkerung opiumsüchtig sei. Schlimm war, daß die staatstragenden Schichten weit überdurchschnittlich beteiligt waren [ . . . ] die Beamten der Pekinger Zentralregierung zu 10%–20% [ . . . ], die der örtlichen Verwaltung zu 20%–30% und die Hilfsmagistrate der Kreise sogar zu 50%–60%. Das Militär war dem Laster in besonderem Maße verfallen [ . . . ] bei den Mannschaften der Küstenkreise (seien) Nichtraucher die Ausnahme.«(17) Opiumhandel war natürlich in China verboten, doch die korrumpierten Verwaltungen und Militärs unternahmen nichts dagegen. Als dann der Kaiser 1839 rigoros vorging, die englischen Händler in Kanton belagern ließ, sie zur Herausgabe des Opiums und zum Verlassen der Stadt zwang, sandte England ein Geschwader Kriegsschiffe in den Fernen Osten. Den modernen Schiffen hatten die
//328//
mit veralteten Waffen kämpfenden Chinesen nichts entgegenzusetzen; England beherrschte die Küstengewässer Chinas. Im Friedensvertrag von Nanking 1842 wurde festgeschrieben, daß sich China den Fremden öffnen müsse: neben einer Entschädigungszahlung von 21 Millionen Silberdollar wurde den Engländern Hongkong zugesprochen, neben Kanton wurden die Häfen Amoy, Foochow, Ninpo und Shanghai den Europäern geöffnet, die sich dort nun auch niederlassen durften. Die Chinesen zögerten die Erfüllung der Vertragsbedingungen hinaus, so daß es 1857 nochmals zu kriegerischen Auseinandersetzungen kam, bei denen Kanton schwer beschossen wurde. Als auch der daraufhin geschlossene Friede von Tientsin von China nicht eingehalten wurde, nahm eine englisch-französische Streitmacht 1860 die Hauptstadt Peking ein. (Bei dieser groben Darstellung bitte ich im Auge zu behalten, daß China zu den Vertragsbrüchen sicherlich berechtigt war, da es ja zu den Abschlüssen gezwungen worden war). Nunmehr erhielt England Kowloon als Besitz, der Yangtsekiang wurde internationalisiert, die Erlaubnis zu missionarischer Tätigkeit im Innern des Landes wurde erzwungen, exterritoriale Rechte und Gerichtsbarkeit wurden gesichert. Das in sich ruhende, riesige chinesische Reich war innerhalb von 40 Jahren zum Spielball europäischer Mächte geworden. Die Mandschus hatten ihr Gesicht verloren, ihre Herrschaft brach zusammen.
Nicht nur im Kampf mit den Europäern versagte die chinesische Armee, auch der immer häufiger werdenden Erhebungen im Lande wurde sie nicht Herr. Die fortschreitende Verelendung großer Bevölkerungsteile (durch Teuerung, Mißernten und Verlagerung der Wirtschaftszentren) und die brutalen Ausbeutungspraktiken des ebenfalls verarmenden Landadels führten dazu, daß rebellierende Geheimbünde Zulauf erhielten: »Es bedurfte nur eines charismatischen Führers [ . . . ], um die Feuer der vielen kleinen Unruheherde in einer gewaltigen Flamme zusammenschlagen zu lassen. Diese Rolle fiel Hung Hsiu-ch'üan (1813– 1864) zu, einem erfolglosen Examenskandidaten.«(18) Er stammte aus ärmlichen Verhältnissen in Kanton, hatte Kontakt zu christlichen Missionaren, deren Lehre er aufnahm und verfremdet weitergab. Er gründete eine Geheimgesellschaft und konnte innerhalb weniger Jahre eine Anhängerschaft von 30.000 um sich scharen. In Kuangsi brach dann 1850 die größte Revolution des 19. Jahrhunderts aus, die T'ai-p'ing-Bewegung. Als die Rebellen 1853 Nanking eroberten, beherrschten sie bereits den größten Teil Süd- und Südostchinas. Die Revolutionäre – mindestens eine Million aktive Mitglieder umfaßte die Bewegung mittlerweile – gründeten einen eigenen Staat, das "Himmlische Reich des großen Friedens" (t'ai-p'ing t'ien-kuo). Diesem Reich stand ein "Himmlischer König" vor, zu dem Hung Hsiu-ch'üan ausgerufen wurde, dem fünf weitere Könige unterstanden. Wichtige Grundsätze dieser Revolution waren: Abschaffung des Privateigentums, allge-
//329//
meine [allgemeine] und gerechte Aufteilung des landwirtschaftlich nutzbaren Bodens, niedrige Steuern, Gleichstellung von Mann und Frau (Frauen konnten Ämter bekleiden, waren sogar Soldaten), alle Suchtmittel waren strengstens verboten.
Wenn die Bewegung auch hauptsächlich aus wirtschaftlichen und sozialen Ursachen heraus entstand, so erhielt sie doch durch ihre Führer starke religiöse Tendenzen, was letztlich mit dazu beitrug, daß die Bewegung scheiterte, denn wegen radikaler Bilderstürmerei gegen die Tempel und die alten Götter blieben viele einfache Chinesen der Revolution fern, und wegen messianischer Ansprüche des "Himmlischen Königs" und erheblicher Ungereimtheiten seiner Dogmatik wurde die Bewegung, deren religiöses Fundament das protestantische Christentum war, von den europäischen Kirchen nicht unterstützt. Hauptgrund für die Niederlage der Revolutionäre jedoch waren schwere politische und taktische Führungsfehler (z. B. Nichteinnahme von Shanghai), die es der Mandschu-Dynastie ermöglichten, Widerstandskräfte zu mobilisieren und schließlich mit Hilfe europäischer Waffen- und Führungshilfe (u. a. durch General Charles Georg Gordon, der später im Mahdi-Aufstand wieder eine bedeutende Rolle spielte) den Aufstand 1864 niederzuwerfen, »auch wenn die Niederschlagung letzter versprengter Truppen sich noch bis 1866 hinzog.«(19)
In den letzten Jahren vor dem Ende des T'ai-p'ing-Aufstandes beginnt die Zeit der "T'ung-chih-Restauration". Unter Leitung des Prinzen Kung, dem Onkel des minderjährigen Kaisers, versuchten Mandschus und Chinesen gleichermaßen, die alte Ordnung wiederherzustellen. Man entschloß sich, die überlegenen Kräfte der europäischen Mächte mit in ein Wiederaufbauprogramm einzubeziehen. Vor allem auf militärischem und technischem Gebiet suchte man die Zusammenarbeit. Der strenge Zentralismus der Mandschu-Regierung wandelte sich zum Regionalismus. Provinzgouverneure wurden zu bedeutenden Machtfaktoren und hielten schlagkräftige Milizen unter Waffen. Da aber die Richtlinie all dieser Bestrebungen die Wiederherstellung der alten konfuzianischen Ordnung war, kam es letztlich doch nicht zu wirklichen Reformen. Nach einer Zeit relativer Ruhe begann dann der endgültige Verfall des riesigen Reiches: Zunächst verlor China im Chinesisch-Französischen Krieg 1884/85 Annam als Vasallenstaat, dann im Chinesisch-Japanischen Krieg den Einfluß auf Korea, mußte Taiwan und die Pescatores-Inseln an Japan abgeben. Weitere Gebietsabtretungen folgten: 1887 an Portugal Macao; im Rahmen von Pachtverträgen 1898 größere Gebiete an England, Frankreich, Rußland – und an das Deutsche Reich (Kiautschou). »Den Status, den China im Laufe dieser Entwicklung erhielt, kann man zutreffend wohl als halb-kolonial charakterisieren. Vor allem die Küstengebiete hatten sich in eine Reihe von Einflußzonen verwandelt, die zum Teil richtige Enklaven darstellten.«(20)
//330//
Durch die für die verlorenen Kriege zu zahlenden Kontributionen, durch verheerende Naturkatastrophen (Überschwemmung) und Dürrezeiten und auch durch Industrialisierung (mechanische Webereien) verelendete ein immer größer werdender Teil der Bevölkerung. Sammelbecken der Unzufriedenen waren wieder die Geheimgesellschaften. Besonders die Vereinigung "Faust(kämpfer) für Recht und Einigkeit" (in Europa "Boxer" genannt) erstarkte so sehr, daß sie Peking einnehmen konnte. »Religiöser, gegen das Christentum gerichteter Fanatismus und Maschinenstürmerei bildeten ihr Aktionsprogramm, das 1899, als die Bewegung auf zunehmende Billigung der Obrigkeit stieß, um den Slogan "Unterstützt die Ch'ing, vernichtet die Fremden" bereichert wurde.«(21) Im Verlauf dieser Unruhen erklärte China den europäischen Mächten den Krieg. England, Frankreich, Rußland, die USA, Italien, Deutschland und Japan mobilisierten daraufhin gegen das Reich; China mußte kapitulieren. Das "Reich der Mitte" kam nicht mehr zu Ruhe: aus dem Ausland (Japan) gesteuerte revolutionäre Bewegungen vereinigten sich und begannen 1911 mit dem Aufstand gegen die Mandschu-Dynastie. Am 12.2.1912 dankte der Kaiser ab, die Republik wurde ausgerufen.
Es sollte eigentlich einer solchen Bemerkung nicht bedürfen, ich will es dennoch ausdrücklich ins Bewußtsein rufen: Diese Darstellung ist eine für die hier vorliegenden Zwecke rigoros vereinfachte und verkürzte Darstellung sehr komplizierter historischer Vorgänge.
1.2. Die historischen Verhältnisse in den China-Romanen Karl Mays
Karl May schrieb keine historischen Romane. Die Frage nach dem historischen Hintergrund in seinen Werken darf also nicht beckmesserisch behandelt werden. Da Mays Werke aber nicht in einem zeitlichen Irgendwann spielen, sondern sich einigermaßen genau datieren lassen, ist zu prüfen, ob der Leser – wie in den geographischen – auch in den geschichtlichen Kontext der Handlung eingeführt wird. Ekkehard Koch hat solche Untersuchungen für die Südamerika-, die Südafrika- und die Sibirien-Episoden bei May durchgeführt und ist zu dem Ergebnis gekommen, daß der jeweilige historische Rahmen durchaus nachzuvollziehen ist.(22) Aber diese umfangreichen, detailgenauen Arbeiten täuschen etwas darüber hinweg, daß dem Mayleser wirkliches historisches Wissen über die vom Mayschen Helden bereisten Gegenden explizit kaum vermittelt wird. Die Anhaltspunkte, die Koch für seine Studien im Werk fand, stehen meist als kurze Einschübe, als vereinzelte Sätze oder sogar nur im Handlungszusammenhang verborgen in den Texten. Sie sind jeweils – bis auf wenige Ausnahmen – eigentlich nur im nachhinein als historische Ausstaffierung zu erkennen, wenn näm-
//331//
lich [nämlich] der Leser sich mit der Geschichte der jeweiligen Region vertraut gemacht hat.
So ist es auch im Falle der China-Texte Mays. Erst nachdem man sich die Geschichte Chinas im 19. Jahrhundert erarbeitet hat, fallen die vielfältigen Bezüge im Werk dazu auf. Dreimal jedoch geht May direkt auf die Geschichte Chinas ein: so erwähnt er die Mohammedaner-Aufstände und den T'ai-p'ing-Aufstand. Über den T'ai-p'ing-Aufstand erfahren wir, daß die Taipings eine neue Religion gründen und die herrschende Dynastie stürzen wollten. Fast wäre ihnen das gelungen. Es dauerte lange Zeit und kostete blutige Kämpfe, bis sie überwunden wurden. Sie lösten sich endlich in Banden auf, welche raubend das Land durchzogen und bis in die südlichen Provinzen kamen. (M 186f.) Nur wenig mehr schreibt May über die Mohammedaner:
Man muß wissen, daß die Mohammedaner der Provinz Yun-nan gelegentlich des Aufstandes der Thai-ping den Versuch gemacht hatten, sich das Recht der freien [Religionsübung] zu erwerben. Sie wurden aber überfallen, wobei man über tausend von ihnen tötete. Infolgedessen traten sie einmütiglich zusammen, eroberten die Hauptstadt Jun-nan-fu und bildeten ein selbständiges Staatswesen, dessen die Regierung selbst heute noch nicht ganz wieder mächtig geworden ist. Sie nennen sich selbst Pan-tse, werden aber von den Gegnern Kuei-tse, Teufelssöhne, genannt. Von allen Seiten bedrängt und bedrückt, unternehmen sie unter kühnen Anführern zuweilen in größerer oder kleinerer Anzahl Züge in die benachbarten Provinzen, um sich für das Erlittene schadlos zu halten. (M 444f.)
Eine genauere Information sähe so aus: »1855 begann der große Aufstand in Yünnan, der sich 17 Jahre lang hinzog und im Westen unter dem Namen "Panthai-Aufstand" bekannt ist. Einer ihrer Führer, Tu Wen-hsiu, eroberte sehr schnell den ganzen Westen der Provinz und gründete jetzt unter dem Titel Sultan Suleiman [ . . . ] ein Königreich, das erst 1872 [ . . . ] gestürzt wurde. 1862 griffen die Unruhen auf Kansu über, anschließend auf Shensi und wurden erst 1876 [ . . . ] niedergeschlagen.«(23)
Da feststeht, daß May für seine Jugendromane eine besondere didaktische Konzeption entwickelte (deren Träger in den Amerika-Romanen der Hobble-Frank ist), sei die Überlegung erlaubt, ob sich hinter den knappen Angaben der Wunsch verbirgt, daß der neugierig gemachte junge Leser sich nach der Lektüre intensiver mit der chinesischen Geschichte mit Hilfe von Fachliteratur beschäftige. Immerhin sind die beiden Textpassagen an zentralen Stellen in den Roman eingearbeitet worden (Kampf auf der Raubdschunke, Schatzsuche; beide Male mit besonderem Bezug zur verschollenen chinesischen Familie). Größere Aufmerksamkeit erheischt – zunächst – der dritte Textteil mit direktem historischen Bezug: An die zu Anfang dieser Arbeit zitierte pathetische Einleitung zum "Kiang-lu" schließt sich eine Passage an, die die politische Situation Chinas drastisch schildert:
//332//
Ich bin nicht aus dem Lande der Franka und Ingli, welche mit Schwert und Pulver zu dir kommen, um deinen Kindern das Gift des Opiums aufzuzwingen, deine Städte zu verheeren und deinen Pings (Soldaten) . . . zu sagen, daß sie Memmen sind. (K 69f. ) Leider wird diese wichtige geschichtliche Information durch die Fortsetzung des Textes verwässert: Ich stamme vielmehr aus dem Lande der Tao-dse . . . , die deine Herrlichkeit bewundern, deine Größe preisen . . . Das Interesse des Lesers wird von der geschichtlichen Lage Chinas auf die Person des Helden und seines nationalen Charakters gelenkt. Doch gibt die kurze Passage einige Stichworte, die, immer wieder im Text auftauchend, die China-Geschichten Mays mit historischem Hintergrund ausstaffieren: Fremdenhaß, ausländisches Konsularwesen, Opium und desolater Zustand von Staatseinrichtungen.
*
Das Thema Fremdenhaß ist für May in besonderer Weise interessant, da er hierbei seiner Sympathie für das chinesische Volk Ausdruck geben kann, so wie er stets für unterdrückte Völker Partei nahm. Darüber hinaus wird durch Informationen hierzu dem Leser die besondere Gefährlichkeit der Unternehmungen der Helden deutlich gemacht. May geht bei Schilderungen von Fremdenhaß in China stets vom Standpunkt der Einheimischen aus: »wir hassen die Fu-lan und die Yankui-dse, die unsere Städte niederschießen und uns mit ihren Kanonen zwingen, sie reich zu machen, indem wir ihnen ihr Gift ( . . . Opium . . . ) abkaufen müssen.« (K 164)(24) In Kanton, der von den Ausländern besonders hart getroffenen Stadt, gestaltet May sogar eine ganze Szene auf der Grundlage des Fremdenhasses: Der deutsche Held und Turnerstick besuchen ein Teehaus im verbotenen Teil der Stadt, die Chinesen verlangen sofortiges Verlassen des Lokals. Wegen der gegenwärtigen Verhältnisse und weil ihm die Argumentation der Chinesen einleuchtet, reagiert der Deutsche betont zurückhaltend (K 241ff.). Heine schreibt dazu: »Europäer haben nur Zutritt in die Vorstädte; beim Betreten der inneren Stadt werden sie meist vom Pöbel mit Schimpfworten begrüßt, zu denen sich auch oft Thätlichkeiten gesellen. [ . . . ] Wenn sich manchmal betrunkene Matrosen ins Innere der Stadt verlieren, kommt es gemeinhin zu Händeln [ . . . ], und oft hören die Blaujacken Steine um die Ohren sausen, eine Begrüßungsformel, die die Chinesen überhaupt sehr zu lieben scheinen; doch sollen bei solchen Gelegenheiten auch Ermordungen vorgekommen sein.« (HEINE 122f.)(25)
Damit ist auch schon der zweite Punkt angesprochen, die europäische Konsulargewalt auf chinesischem Gebiet. Im "Kiang-lu" ist es damit noch nicht ganz so weit gediehen wie im "Methusalem": die Erzählung spielt ja auch einige Jahre früher. So erfahren wir in der Drachenmänner-Episode, daß die Konsuln nicht immer mit Erfolg auf Bestra-
//333//
fung [Bestrafung] der Verbrechen gegen Ausländer bestehen, da hohe Mandarine zu den Verbrechern halten (K 142), und K 222 betont May, daß die Vertreter fremder Mächte damals . . . eine . . . schwierige Stellung hatten. Im "Methusalem" dagegen wird angezeigt, daß ohne Zweifel die Konsuln dafür sorgen werden, daß die gefangenen Seepiraten gehängt werden (M 180), und der hohe Beamte Tong-tschi weist seinen Untergebenen zurecht: »Sie wissen doch, daß wir keinen Fremden bestrafen dürfen. Wenn ein Ausländer gegen unsere Gesetze handelt, so haben wir ihn seinem Gesandten zur Bestrafung auszuliefern. Selbst wenn diese Leute nur Fu-len sind, so werden sie sich bei dem Vertreter ihres Herrschers über Sie beschweren, und wir sind dann gezwungen, alle, welche eine Klage trifft, auf das strengste zu bestrafen.« (M 353f.)
Was hat es nun konkret mit der Konsularhoheit auf sich? Die europäischen Staaten erzwangen eine Begrenzung der territorialen Souveränität Chinas insofern, daß »westliche Bürger nicht dem Wirkungsbereich des lex loci unterliegen, sondern einer eigenen nationalen Gerichtsbarkeit auf chinesischem Territorium unterstehen sollten.«(26) Zunächst war dieses Prinzip der Exterritorialität auf die fünf gewaltsam geöffneten Häfen beschränkt. Im Britisch-chinesischen Vertrag von Nanking vom August 1842 heißt es:
»Wenn immer ein britischer Staatsangehöriger Anlaß hat, gegen einen Chinesen Klage zu erheben, muß er zunächst vor das Konsulat gehen und den Grund für seine Klage darlegen. Der Konsul wird daraufhin der Sache auf den Grund gehen [ . . . ] Wenn unglücklicherweise Kontroversen solcher Art auftreten, daß der Konsul keine gütliche Einigung herbeiführen kann, soll er die Hilfe eines chinesischen Beamten in Anspruch nehmen, damit sie gemeinsam der Angelegenheit auf den Grund gehen und sie gerecht entscheiden können. Hinsichtlich der Bestrafung britischer Verbrecher wird die britische Regierung diejenigen Gesetze erlassen, die zu diesem Zwecke nötig sind, und der (zuständige) Konsul wird ermächtigt werden, sie in Kraft zu setzen«,(27)
und im Chinesisch-amerikanischen Vertrag von Wang-hsia (Juli 1844):
»Bürger der Vereinigten Staaten, die in China ein Verbrechen begehen, dürfen nur vom Konsul oder einer anderen Amtsperson der Vereinigten Staaten vor Gericht gestellt und bestraft werden.«(28)
1858 wurde die exterritoriale Gewalt der Konsuln in den Verträgen von Tientsin erweitert, 1880 auf ganz China, anwendbar auf alle interessierten europäischen Nationen. »Die exterritoriale Gerichtsbarkeit wurde hauptsächlich durch die Konsulargerichte bzw. in Peking durch die Gesandtschaftsgerichte ausgeübt. Außerdem hatten die USA und Großbritannien eigene nationale Gerichtshöfe in Shanghai.«(29) Darüber hinaus hatten die fremden Mächte über ihre Konsulate folgende Privilegien:
//334//
»Westlich verwalteter Zolldienst, westlich verwalteter Post- und Telegraphendienst, westlich verwaltetes Salzsteueramt, westlich kontrollierte Niederlassungen und Konzessionen. Recht der Stationierung westlichen Militärs in China. Recht zur unbeschränkten Binnenschiffahrt, Befreiung westlicher Bürger vom chinesischen Steuerwesen, westliches Missionsrecht mit unbeschränktem Recht zur Erwerbung von Grund und Boden.«(30)
*
Außer in den schon zitierten Textstellen zum Fremdenhaß geht May auf das Problem "Opium" noch dreimal ein, und zwar in der kurzen Bemerkung, daß der Kommandeur der Kriegsdschunke, die Methusalem und seine Freunde nach Norden bringt, ein Opiumraucher sei und dem zehrenden Gifte seine Gesundheit und alle seine Energie geopfert habe (M 404), in der Episode auf der Piratendschunke, als die Helden mittels in den Sam-chu gemischten Opiums außer Gefecht gesetzt werden, bei welcher Gelegenheit der Leser darüber informiert wird, welche Gegenmittel man gegen einen Opiumrausch anwendet (M 156f.), und in der Schilderung einer Opiumbutike (K 240f.), die wohl von einem Etablissement dieser Art in Macao angeregt wurde, das Heine besuchte:
»In den Freudenhäusern wurden gewöhnlich Thee und andere Erfrischungen verabreicht und viel Opium geraucht. In den Gemächern waren ungewöhnlich große Lagerstätten mit Matten bedeckt. Die Insassen derselben waren entweder beim Abendessen, aus allerhand Schnitzeleien und Leckereien bestehend, und dazu Thee oder Sam-chou (ein berauschendes Getränk aus Reis bereitet) trinkend, oder lagen, Opium rauchend, auf jenen Lagerstätten. Zu letzterem Zwecke stand auf einem kleinen Brettchen eine Lampe mit kurzem Docht. Die Pfeife ist 18–20 Zoll lang und hat einen noch kleineren Kopf als an den hiesigen Tabakspfeifen. Ein wenig präparirtes Opium (dickem Syrup nicht unähnlich), in Quantität eines Hirsekornes, wird vermittelst einer Nadel in den Pfeifenkopf gebracht; der Raucher, auf dem Bett liegend, nähert den Pfeifenkopf der Lampe und leert den Inhalt in 3, 4 Zügen, den Rauch in die Lunge einziehend. Manche begnügen sich mit noch geringerer Quantität und fühlen dann nur eine ähnliche Wirkung, wie wir nach einer sehr starken Cigarre, Andere aber wiederholen die Dosis so oft, bis sie sinnlos hinfallen, worauf sie während mehrerer Stunden in einem betäubten Zustande daliegen. Wieder Andere hatten während des Rauchens Mädchen um sich, die einen wunderlich klingenden näselnden Gesang auf einer langgehalsten Zither begleiteten. Meinem barbarischen Ohre glich diese musikalische Unterhaltung mehr einer nächtlichen Dachzusammenkunft der Katzen im Mai; möglich indeß, daß sie in den Ohren eines halbhinduselnden Opiumrauchers gar hold und lieblich klingt.« (HEINE 263f.)
Neben dem hohen wirtschaftlichen Schaden, den der Opiumhandel dem chinesischen Reich zufügte, gefährdete die massive Einfuhr dieses gefährlichen Rauschgiftes die Volksgesundheit in unerträglichem Maße: Opium, lat. laudanum, ist der zu dunkelbrauner Masse eingetrocknete Saft des Schlafmohns. Diese Mohnart wird in Kleinasien,
//335//
Indien, Persien und China angebaut. Schon im Altertum wurde Opium als Heil- und Betäubungsmittel eingesetzt (es enthält Morphium).
»Der Mißbrauch des O-s scheint v. Persien ausgegangen zu sein, [ . . . ] Die Mohammedaner bedienen sich des O-s häufig, um den ihnen verbotenen Wein zu ersetzen. Der O-genuß ist schädlich, weil bei längerem Gebrauche der dadurch erregten Exaltation später Schwäche u. geistige Stumpfheit folgt, u. außerdem Siechtum mit Abmagerung konstant eintritt. Die O-esser beginnen mit 0,03 g u. steigern den Genuß bis auf 7,5 g u. mehr. Die Wirkung tritt nach einer Stunde ein u. hält 5 bis 6 Stunden an. Der O-genuß ist namentlich in China außerordentlich verbreitet: 1875 wurden 3.805.479 kg eingeführt. [ . . . ] In mäßiger Dose bewirkt O. Abstumpfung v. Schmerzgefühl u. Schlaf [ . . . ] Die größte nach dem »Arzneibuch für das Deutsche Reich« (1890) zulässige Einzelgabe beträgt 0,15 g, die größte tägliche Gabe 0,5 g. Größere Mengen rufen Schlafsucht u. narkotische Vergiftung hervor, verwirren den Geist, erregen die angenehmsten Träume u. lassen alle Wünsche der erhöhten Einbildungskraft als erfüllt erscheinen; der Tod erfolgt schließlich durch Lähmung des Atemzentrums. [ . . . ] Gegenmittel gegen O. sind: Kampher, Tannin, Jod, Belladonna, Atropin, Kaffee, Sauerstoff, künstliche Respiration etc.«(31)
Gerade die in Verwaltung und Militär Tätigen waren in hohem Maße Opiumraucher. Huc schreibt dazu: »die Mandarinen geben dem Volk ein schlechtes Beispiel, und wir haben auf unserer langen Reise in China kein einziges Tribunal gesehen, wo nicht ganz offen Opium geraucht worden wäre.« (HUC 13) Da das chinesische Staatssystem auf dem Beamtentum fußte, schwächte diese Sucht den Staat in besonderem Maße.
*
Über den schlechten Zustand des chinesischen Staatswesens wird der Leser durch einen Blick hinter die Kulissen des Militärwesens und der Rechtsprechung informiert. Dabei fallen dann auch einige Worte über die allgemeine Korruption in China.
May tönt zwar laut, daß er nicht wie die anderen Ausländer die chinesischen Soldaten Memmen schimpfen wolle, aber er tut es doch: er läßt keine Gelegenheit aus, Soldaten lächerlich zu machen; allerdings nicht im "Kiang-lu", sondern im "Methusalem". Dort (M 417f.) gibt er eine parodistische Beschreibung der Begleittruppe der Helden und läßt Gottfried von Bouillon bemerken: »O China, wie habe ich mich in dich jetäuscht! . . . Deine Köche will ich loben, aber deine Soldaten kannst du nur jetrost wieder in die Schachtel thun!« (M 419); der Mandarin Tongtschi muß zugeben: »Ich bin Chinese, aber ich kenne unsere Mängel und weiß recht gut, weshalb wir in jedem Kriege, den wir mit den Fremden führen, geschlagen werden und geschlagen werden müssen.« (M 372f.). Daß chinesisches Militär auch gegen Aufständische und Verbrecher nicht viel ausrichtet, macht May durch die Schilderung eines fiktiven Kampfes von Soldaten gegen Piraten klar (M 95).
//336//
Die chinesische Armee befand sich im 19. Jahrhundert in der Tat in desolatem Zustand. Ihr Verfall hatte mehrere Gründe: Die Streitmacht bildeten die "Armee der acht Banner" und die "Grünen Bataillone". Die acht Banner stellten die Hausmacht der Mandschu-Dynastie dar. Die Grundlage dieser Armee, die nur aus Mandschus bestand, war ein erbliches Rekrutierungssystem. Deshalb und durch zermürbendes Garnisonsleben hatte sie im Laufe der Jahre ihre Schlagkraft eingebüßt. Die "Grünen Bataillone" »im Prinzip auf freiwilliger Basis rekrutiert . . . versahen Polizei-, Wach- und Transportdienste.«(32) Da nach konfuzianischer Auffassung der Soldat das unwichtigste Glied der Gesellschaft war und da viele politisch und strafrechtlich Verfolgte in der Armee dienten, fanden die Soldaten dieser Bataillone im Gemeinwesen wenig Beachtung. Sie waren in der Regel mit Bogen, Speeren, Hellebarden und Luntenflinten bewaffnet. Erst nach dem katastrophalen Zusammenstoß mit westlichem Militär und den Niederlagen im T'aip'ing-Aufstand, wurde an einer Modernisierung der Armee gearbeitet. Westliche Waffensysteme und Militärausbildung wurden eingeführt; die Provinzgouverneure hoben Bauernmilizen aus, die von westlichen Experten beraten wurden. Wie der französisch-chinesische und der japanisch-chinesische Krieg zeigten, hatte sich das militärische Niveau jedoch nicht wesentlich verbessert.
Daß May in seiner Parodie chinesischen Soldatentums nicht allzusehr übertrieb, wenn er auch nicht ganz seine Handlungszeit beachtete, zu der es nicht mehr so extrem war, zeigt uns der Bericht Hucs von einer chinesischen Militärparade:
»Am Tage der Heerschau frühstückten unsere beiden Kriegshelden, leerten eine Schaale Weins, setzten einen Strohhut auf, und zogen einen schwarzen, mit breiten rothen Streifen besetzten Rock an. Auf diesem befand sich vorne und hinten ein weißes Stück Zeug, auf welchem das Schriftzeichen Ping stand, das heißt Soldat. [ . . . ]
Die Krieger kamen in kleinen Rotten heranmarschirt, mit Flinten, Bogen, Lanzen, Säbeln, Dreizacken und sogar mit Sägen an einem langen Stiele, mit Schilden aus Bambusgeflecht, und mit einigen Feldschlangen, denen die Schultern zweier Soldaten als Laffette dienten. In diesem bunten Gewirr fiel uns aber doch eine Uebereinstimmung auf; Jeder hatte einen Fächer und eine Tabakspfeife, viele trugen auch einen Schirm unter dem Arme. [ . . . ] Die Uebung begann; das Zeichen wurde durch Abfeuern einer Feldschlange gegeben; [ . . . ] Kesselpauken erdröhnten, die Soldaten liefen durcheinander, schrieen, drängten sich um die Fahnen ihrer Rotte, und versuchten sich einigermaßen zu ordnen; doch gelang das nur sehr dürftig. Darauf ein Scheingefecht mit allerlei Schwenkungen. Man kann sich kaum etwas Komischeres denken als solch eine chinesische Heerschau. Die Soldaten laufen vorwärts, gehen zurück, springen, hüpfen, verkriechen sich hinter den Schild, als wollten sie den Feind erspähen; stehen rasch auf, hauen von rechts nach links um sich, und rennen von dannen, mit dem Rufe: Sieg, Sieg! Es kommt Einem vor als sähe man eine Seiltänzerbande. [ . . . ]
//337//
Nach dieser großen Schlacht mußten ausgewählte Compagnien manövriren. [ . . . ] Die Füsilire und Bogenschützen zielten nach der Scheibe, und zeigten darin eine große Geschicklichkeit. Die chinesischen Flinten haben keinen Kolben, sondern nur einen Handgriff wie die Pistolen, werden auch nicht an die Schulter gesetzt, sondern oberhalb der Hüfte; bevor man den Haken mit der brennenden Lunte fallen läßt, zielt man nicht vermittelst eines Korns, sondern indem man das Ziel ins Auge faßt, ohne sich weiter um das Gewehr zu kümmern. Wir haben uns überzeugt, daß diese Methode sehr zweckmäßig ist. Die Chinesen also zielen nicht, sondern machen es beim Schießen wie wir, wenn wir mit einem Steine nach irgend einem Gegenstande werfen.
Wir haben schon bemerkt daß die Feldschlangen keine Laffetten haben, sondern von zwei Mann auf der linken Schulter getragen werden; mit der rechten Hand hält man sie fest. Diese menschlichen Böllerunterlagen gewähren einen merkwürdigen Anblick wenn Feuer gegeben wird. Sie bemühen sich Ruhe und Seelengröße zu behaupten, aber ihre Lage ist doch so kritisch, daß sie zucken und die Miene verziehen. Die kaiserliche Regierung hat, in väterlicher Fürsorge für diese Feldschlangenträger, wohlweislich verordnet, daß ihnen die Ohren mit Baumwolle verstopft werden, und wir konnten uns durch den Augenschein überzeugen, daß dieser Befehl nicht unbeachtet bleibt. Daß mit derartigen Kanonen nicht viel auszurichten ist, braucht nicht erst ausdrücklich bemerkt zu werden.« (HUC 168ff.)(33)
Das chinesische Rechtssystem als desolat zu bezeichnen oder darzustellen, entspringt natürlich dem überheblichen Blickwinkel des aufgeklärten Europäers. Doch für die Handlungszeit der May-Erzählungen ist diese Bewertung durchaus angebracht. Zweimal schildert May eine Gerichtsverhandlung: Im "Kiang-lu" stehen die Helden selbst vor dem Richter. Die Verhandlung ist kurz, die Chinesen, die ja eigentlich im Recht waren, werden kurzerhand zu der schweren Strafe von drei Jahren Verbannung und zehn Tagen Block verurteilt. Im "Methusalem" wohnen die Helden einer Verhandlung bei. Auch hier geht es sehr schnell und ohne Formalitäten zu; in den beiden hierbei behandelten Fällen werden Kläger und Beklagte mit der gleichen Strafe belegt: mit sofort vor Publikum vollzogenen Stockhieben (M 316). Insbesondere mit einem speziellen Rechtsverständnis der Chinesen macht May den Leser bekannt, mit dem Prinzip, daß die Verwandten eines Uebelthäters seine Vergehen mit zu büßen haben (M 189), daß sogar derjenige, auf dessen Grund und Boden oder auch nur in dessen Nähe ein Verbrechen geschieht . . . ganz unerbittlich mitbestraft (wird) (M 252) und daß auch die jeder Straße zugeordneten Aufsichtspersonen und die jeweils zuständigen Mandarine zur Verantwortung gezogen werden (M 280, 292, 297). May gestaltet mit diesem Prinzip eine ganze Abenteuerepisode des Romans: die Geschichte von den verfeindeten Juwelieren Wingkan und Hu-tsin und dem Götterraub. Der doch ziemlich bedeutende Fall wird dann dadurch gelöst, daß der Mandarin, um sich selbst zu schützen, dafür sorgt, daß die Übeltäter aus dem Gefängnis entfliehen
//338//
können, damit sie keine Aussage machen und damit die europäischen Gäste mit in Gefahr bringen.
Doch wenden wir uns nach Mays Beispielen aus der Praxis der Theorie zu. In China gab es nur ein Straf- und ein Ritenrecht, kein ausreichend ausgearbeitetes Zivil- und Prozeßrecht. Im Ta Ch'ing lü, dem Rechtskodex der Chinesen, waren Tatbestände aufgeführt und die dazu gehörigen Strafen angegeben. Als Strafen kamen in Frage: Prügel, Zwangsarbeit, Verbannung (d. h. meist Einziehung in die Armee) und Tod. All diese Strafen waren nach einem besonders differenzierten System durch Geld anzuwenden. Das hatte zur Folge, daß nur Arme Prügelstrafen oder Verbannung tatsächlich erleiden mußten. Beamte wurden in der Regel nicht geprügelt, sie erhielten Geldstrafen oder wurden degradiert. Sie waren in außergewöhnlichem Maße von Strafen bedroht, da »schon Ungeschicklichkeiten, Verletzung der komplizierten Formvorschriften«(34) Straftatbestände sein konnten. Der Kodex unterschied bei der Festlegung von Straftatbestand und Strafe die Täter auch im Hinblick auf ihr persönliches Verhältnis zum Opfer: So konnten »der Hausherr und seine Frau Hausangehörige (Kinder, [ . . . ] als spätere Schwiegertochter gekaufte Mädchen, Sklaven, Lohnarbeiter) unter dem Vorwand, sie hätten Befehle verletzt, straffrei totprügeln. [ . . . ] Strengere Strafen [ . . . ] bis zur Todesstrafe waren vorgesehen, wenn das Opfer ein älterer Verwandter des Täters war.«(35)
Im Prozeß gab es keinen Staatsanwalt. Klage führten Betroffene oder Polizeibeamte; auch Verteidiger waren in der Regel nicht anwesend, wenn auch zugelassen. Als Beweis galt einzig das Geständnis. Aus diesem Grunde war Folter üblich – und erlaubt. Klage zu erheben war nicht minder heikel als angeklagt zu sein, da z. B. auf falsche Anklage die gleiche Strafe stand wie auf das vorgetragene Unrecht, so daß oft Kläger und Beklagte zusammen lange Zeit in Untersuchungshaft saßen. Für die Rechtspflege zuständig waren a) die Dorfältesten bei einfachen Zivilfällen, b) Provinzzensoren, die die Rechtsprechung kontrollierten und liegengebliebene Fälle an sich ziehen konnten, c) die Präfektur bei Fällen von Verbannung, d) die Provinzbehörden unter dem Gouverneur bei besonders schweren Vergehen, e) der Kaiser, der Todesurteile bestätigen sollte (in der Praxis aber ausgesuchte Fälle vorgelegt bekam). Die Anrufung der nächsthöheren Instanz war möglich, stand aber unter Strafe, wenn nur aus Prozeßsucht ungerechtfertigte Klagen weiterverfolgt wurden.
Die Beispiele zum Thema Rechtssprechung, die May gestaltet, sind nicht allein seiner blühenden Phantasie entsprungen. Sie gehen im Kern auf Schilderungen Hucs zurück, der sehr ausführlich über das chinesische Rechtssystem referiert und über Verhandlungen, an denen er teilnahm, und den Vollzug grausamer Strafen und Foltern, dem er zusah, berichtet.(36) Das von May als handlungstragendes Element ver-
//339//
wandte [verwandte] Prinzip der umfassenden Verantwortlichkeit bei Straftaten findet sich bei Huc auf S. 288 beschrieben:
»das Meisterstück der chinesischen Gesetzgebung ist enthalten in dem weitumfassenden S y s t e m e v o n S o l i d a r i t ä t welches sie aufstellt. Vermittelst desselben machte sie jeden Einwohner des Reiches verantwortlich für das Betragen seines Nachbars oder Verwandten, seines Vorgesetzten oder seines Dieners. Namentlich lastet diese fürchterliche Verantwortlichkeit auf den Beamten, aber sie ist auch für den gewöhnlichen Privatmann im höchsten Grade drückend. Je hundert Familien bilden einen Bezirk, und ernennen einen Aufseher, der nebst sechs Beisitzern die Abgaben beitreibt. Er ist aber zugleich für eine Menge von Vergehen verantwortlich, welche sich etwa in seinem Bezirke ereignen. Er erhält zum Beispiel, je nach Umständen, zwanzig bis achtzig Hiebe, wenn die Felder nicht gut bestellt worden sind.«
Daß bei einem solchen Rechtssystem Machtmißbrauch in besonderem Maße möglich ist, liegt auf der Hand. Kläger und Angeklagte sind oft ganz in die Hand der Richtenden gegeben. Diese erhielten zudem sehr niedrige Gehälter; Huc schreibt, daß den niederen Beamten beim Tribunal gar keine Besoldung gezahlt wurde. Darüber hinaus ist durch das Prinzip, daß Beamte nicht in ihrem Heimatbezirk tätig sein durften und ständig versetzt wurden, in den Amtsstuben eine hauptsächlich an Gewinnsucht orientierte Mentalität entstanden:
»Die Corruption in ihrer widerwärtigsten Gestalt dringt in alle Verhältnisse ein, das Recht wird an den Meistbietenden verkauft, und die Mandarinen aller Classen schützen nicht etwa das Volk, sondern bedrücken und plündern es auf jede nur denkbare Art und Weise.« (HUC 46).
An mehreren Stellen im Text erwähnt oder schildert May Korruption von Beamten und Priestern, geht aber nicht näher darauf ein.(37) So ist es insgesamt mit dem historischen Hintergrund in Mays Chinatexten: Wenn man nach ihm sucht, ist er durchaus – und auch durchaus solide – vorhanden, doch überwiegt das Handlungselement so stark, daß die gegebene Information stets in der Gefahr steht, überlesen zu werden.
(Wird fortgesetzt)
1 Karl May: Gesammelte Reiseerzählungen Bd. XI: Am Stillen Ozean. Freiburg 1893 S. 67–318 (S. 69) (künftig: K)
2 Kartenskizze verkleinert und vergröbert nach: Albert Kolb: Ostasien. Heidelberg 1963, zwischen S. 80 u. 81
3 Sohr-Berghaus. Handatlas über alle Teile der Erde. Glogau 61877, verkleinerte und vergröberte Skizzen nach der Karte Nr. 81. Karl May besaß laut Bibliotheksverzeichnis (Karl-May-Jahrbuch 1931. Radebeul o. J. S. 217) diese Auflage dieses Atlasses (dort allerdings mit Glogau 1874 angegeben).
//340//
4 Erwin Koppen: Karl May und China. In: Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft (Jb-KMG) 1986. Husum 1986 S. 69–88 (S. 86)
5 Zitiert wird mit dem Sigel M nach der historisch-kritischen Ausgabe: Karl Mays Werke. Historisch-kritische Ausgabe. Abt. III. Bd. 2: Kong-Kheou, das Ehrenwort. Hrsg. von Hans Wollschläger und Hermann Wiedenroth. Nördlingen 1987.
6 Koppen wie Anm. 4 S. 78, vgl. M 182.
7 Roland Schmid: Nachwort (zu "In den Cordilleren"). In: Karl May: Freiburger Erstausgaben Bd. XIII. Hrsg. von Roland Schmid. Bamberg 1983 N15
8 Darauf deutet z. B. Turnersticks Anrede Charley hin; mit gleichem Recht könnte man hier allerdings auch den Namen Kara Ben Nemsi verwenden.
9 Ansgar Pöllmann: Kritische Spaziergänge: XIII. Ein Abenteurer und sein Werk. III. Ein literarischer Dieb. In: "Über den Wassern". Münster 1910
10 Karl-May-Jahrbuch 1931 wie Anm. 3 S. 227
11 Angaben zu Huc und Gabet nach: Enzyklopädie der Entdecker und Erforscher der Erde. Bd. 2. Graz 1983 S. 309, 641–44, Zitat Sven Hedin S. 642
12 Alle Daten wie Anm. 11, Stichwort "Heine" S. 560f.
13 Schreibweise und Daten nach: China-Handbuch. Hrsg. von Wolfgang Franke/Brunhild Staiger. Düsseldorf 1974; Stichwort "Ch'ing-Dynastie" Sp. 225–231
14 Charles Patrick Fitzgerald: China. München 1967 S. 564
15 Zahlen nach Kolb wie Anm. 2 S. 83; nach Fischer Weltgeschichte Bd. 19: Das Chinesische Kaiserreich. Hrsg. von Wolfgang Franke/Rolf Trauzettel. Frankfurt a. M. 1979 S. 311, stieg die Bevölkerungszahl von 1802–1834 um 100 Millionen.
16 Fitzgerald wie Anm. 14 S. 562ff.
17 Rainer Hoffmann: Der Untergang des konfuzianischen China. Wiesbaden 1980 S. 39f.
18 Fischer Weltgeschichte wie Anm. 15 S. 316
19 Ebd. S. 319
20 Ebd. S. 326
21 Ebd. S. 334
22 Vgl. die Aufsätze von Ekkehard Koch in den Jb-KMG 1979, 1981 und 1986
23 China-Handbuch wie Anm. 13 Sp. 575; aus seinem Brockhaus-Conversations-Lexikon. Bd. 4. Leipzig 1883 S. 291, konnte May entnehmen, daß die Stadt Jun-nan-fu im Jahre 1868 erobert wurde.
24 Auch hier folgt sofort eine Wendung auf die guten Deutschen.
25 Fremdenhaß wird noch erwähnt M 227 und K 150.
26 China-Handbuch wie Anm. 13 Sp. 335
27 Ebd.
28 Ebd.
29 Ebd. Sp. 336f.
30 Ebd. Sp. 335
31 Pierers Konversationslexikon. Bd. 9. Stuttgart 71891 Sp. 1513
32 China-Handbuch wie Anm. 13 Sp. 886
33 Huc geht im Anschluß an die Parade auf die chinesische Marine ein. May entnahm die Beschreibung der Kriegsdschunken (K 149, M 371 u. 400) jedoch nicht HUC, sondern HEINE 117.
34 China-Handbuch wie Anm. 13 Sp. 1086
35 Ebd.
36 HUC 283–299
37 Vgl. K 222, 239, 247f.; M 302
Inhaltsverzeichnis
Alle Jahrbücher
Titelseite
Impressum Datenschutz